Michael Moor
Student der HumanmedizinInteressiert sich für:
- Effektiver Altruismus
- Evidenzbasierte Medizin
- Populationsethik
- Wissenschaftstheorie
- Bayessche Statistik
- Personal identity
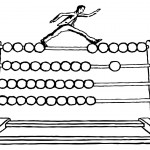 Zahlenscheu kann tödlich enden
Zahlenscheu kann tödlich enden
Das Errechnen eines Erwartungswertes in den fünf besprochenen Schritten mag sich als aufwendig herausstellen. Dass es aber dennoch wichtig ist, nach dem Erwartungswert vorzugehen, zeigt der vorangehende Artikel. Deshalb folgt nun ein Beispiel aus dem medizinischen Alltag (in Anlehnung an „Das Bayestheorem und der Base-Rate-Fehlschluss“): (1) Peter erhielt soeben ein positives Testergebnis, welches besagt, dass er […]
weiterlesen Hohe Erwartungen an den Erwartungswert
Hohe Erwartungen an den Erwartungswert
Die Einen mag der Erwartungswert davon abhalten Lotterie-Scheine zu kaufen, die Anderen ziehen ihn zu Rate, um dem schweren operativen Eingriff, der einem ihrer Elternteile bevorsteht, einen reibungslosen Ausgang zuzuschreiben. Der gezielte Einsatz dieses Instruments mag sich in alltäglichen Situationen als hilfreich herausstellen, aber ist er auch gerechtfertigt? Wird nun die Frage gestellt, ob der Erwartungswert […]
weiterlesen Und übrig bleibt die Null
Und übrig bleibt die Null
Der Artikel „Überzeugungen müssen sich ausbezahlen“ zeigte uns, dass eine Überzeugung wie „In meiner Garage befindet sich ein Drache, den ich weder sehen, riechen, hören, schmecken noch ertasten kann.“ uns nicht weiter bringt. Die epistemische Leere dieser Überzeugungen ist nicht der einzige Grund, warum wir diesen angeblichen Drachen nicht in unsere Entscheidungsfindung miteinbeziehen. Selbst wenn […]
weiterlesen Schlechte Statistik – Das Ende einer Ära
Schlechte Statistik – Das Ende einer Ära
Null Hypothesis Significance Testing (NHST) stellt eine Standardmethode in der Auswertung von Experimenten dar. Diese Methode verwendet sogenannte p-Werte. Diese geben die Wahrscheinlichkeit an, bestimmte Daten zu erhalten, gegeben dass die Null-Hypothese (Annahme, dass der untersuchte Effekt nicht vorhanden ist) zutrifft. Hierbei stellt sich folgende Frage: Soll nicht die Wahrscheinlichkeit für das Zutreffen einer Hypothese bei […]
weiterlesen Experimenter Bias: Sieben Abschnitte der Fehlbarkeit
Experimenter Bias: Sieben Abschnitte der Fehlbarkeit
WissenschaftlerInnen sind kluge Menschen. Doch auch kluge Menschen sind nicht vor kognitiven Denkfehlern gefeit. Sie sprechen auf Anreize an, die einer rationalen Wissensgenerierung entgegenwirken. Folglich sollte davon ausgegangen werden, dass ein Experiment auch von den Durchführenden selbst verfälscht werden kann. Der Experimenter Bias kann sich in verschiedenen Abschnitten der Forschungsarbeit negativ auswirken: 1. Einlesen in das Themengebiet […]
weiterlesen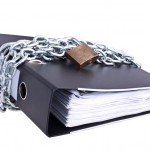 Publication Bias: Ungeschick oder Absicht?
Publication Bias: Ungeschick oder Absicht?
Der Publication Bias liegt vor, wenn unliebsame oder uninteressante Studienergebnisse nicht veröffentlicht oder gar unter den Tisch gekehrt werden. Sowohl die Reviewer als auch die Leserschaft erliegen der Gefahr, falsche Schlüsse zu ziehen, weil nicht die Gesamtheit aller durchgeführten Studien öffentlich zugänglich ist. In manchen Fällen kann dies dramatische Folgen haben, wenn z.B. eine ineffektive […]
weiterlesen Wie man die Wissenschaft repariert – eine Standortbestimmung
Wie man die Wissenschaft repariert – eine Standortbestimmung
Im Jahre 2005 wiesen verschiedene Analysen1 darauf hin, dass der Grossteil von publizierten Studienresultaten der medizinischen Forschung fehlerhaft ist. Ein Bericht2 von 2008 zeigt, dass etwa 80 Prozent der akademischen Artikel in Fachzeitschriften statistische Signifikanz mit umgangssprachlicher Signifikanz verwechselten. Vor diesem grundlegenden Fauxpas in der Statistik warnt schon die Einführungsliteratur. 2011 zeigte eine ausführliche Untersuchung3, dass die Hälfte der […]
weiterlesen Evidenzbasierte Medizin – Wie weiss ich, was wirkt?
Evidenzbasierte Medizin – Wie weiss ich, was wirkt?
„Meinem Onkel hat das immer geholfen und bei mir wirkt es auch.“ oder „Was nicht nützt, schadet auch nicht.“ sind im Alltag oft gehörte Beispiele für anekdotisches Wissen über Medizin und Medikamente. Hierbei handelt es sich aber weniger um valides medizinisches Wissen, als um durch Erfahrungen und Erzählungen akkumulierte Überzeugungen oder gar Mythen. Und solch […]
weiterlesen Randomisierte kontrollierte Studie – Welche Pille ist die beste?
Randomisierte kontrollierte Studie – Welche Pille ist die beste?
Die randomisierte kontrollierte Studie (englisch RCT für randomized controlled trial) ist das erwiesenermassen beste Studiendesign medizinischer Forschung und bildet die Basis evidenzbasierter Medizin. Ein RCT liefert auf eindeutige Fragestellungen Ergebnisse mit optimaler Aussagekraft. Oftmals handelt es sich dabei um Fragen der Kausalität, sprich „Führt Parameter P zu Zustand Z?“ oder „Senkt Medikament M die Ausprägung des […]
weiterlesen